Der kreative Mensch
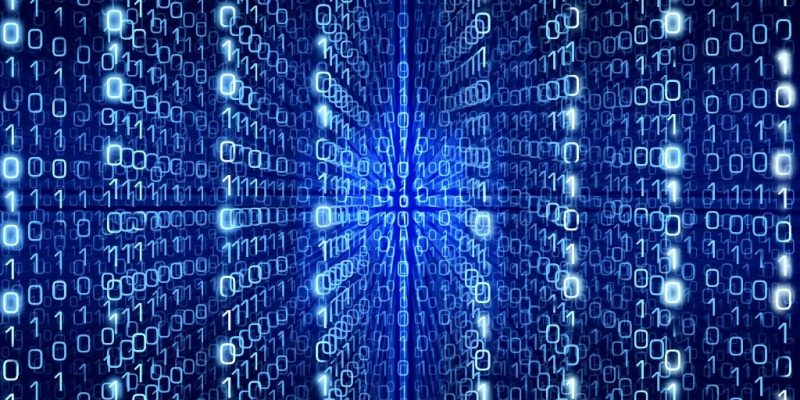
In seiner Jahrtausende andauernden kulturgeschichtlichen Entwicklung hat der Mensch unzählige technische Innovationen hervorgebracht. Das zeigen die vielen archäologischen Funde nicht zuletzt aus Niederbayern, das an Bodendenkmälern reich ist.
Die Entdeckung und kontrollierte Verwendung des Feuers, die Erfindung einfacher Werkzeuge während der Vor- und Frühzeit sowie ihre permanente Fortentwicklung danach waren nicht weniger revolutionär als die Erfindung und Anwendung des Personal Computers seit der Moderne. Letzteres mag für junge Menschen, welche mit Smartphone und Tablet aufwachsen, das Telefon mit Wählscheibe oder die mechanische Schreibmaschine nur mehr aus dem Museum kennen, bereits ewig lange zurückliegen. Doch kultur- und entwicklungsgeschichtlich betrachtet stehen wir erst am Anfang des digitalen Zeitalters mit all seinen Vorteilen und Problemen. Diese Doppelwertigkeit im Sinne von Fluch und Segen scheint vielen Neuerungen quer durch die Geschichte, und noch mehr ihrer Nutzung, innezuwohnen. Denn nicht die Erfindungen per se sind gut oder schlecht. Für deren nutzbringenden oder destruktiven Einsatz entscheiden sich vielmehr die Anwender.
Schon der Steinzeitmensch konnte sich am Feuer wärmen und zugleich damit brandschatzen. Das uralte Messer ist als Werkzeug zur Nahrungszubereitung unentbehrlich, aber ebenso wird es seit seiner Erfindung als Mordwaffe missbraucht. Die Digitalisierung beschert uns heute Kommunikationsmöglichkeiten, von denen wir einst nicht einmal geträumt hätten; gleichzeitig macht sie uns gläsern und angreifbar. Denn wo nicht nur kriminelle Hacker, sondern pubertierende Pennäler problemlos in hochkomplexe Systeme eindringen und Daten ausspionieren können, wird neben den technischen Sicherheitslücken eines offensichtlich: Die Ohnmacht, mit der wir all den möglichen Missbräuchen gegenüberstehen. Weder in seiner positiven noch negativen Energie ist der Mensch berechenbar. Einerseits beweist er sich stets aufs Neue in seiner Genialität, andererseits erweist er sich auch als beständiges Sicherheitsrisiko.
Einem anderen riskanten Phänomen, nämlich der menschlichen Fehleranfälligkeit, die beispielsweise durch Unachtsamkeit, Überforderung oder Fehleinschätzung im Straßenverkehr zu schwerwiegenden Unfällen führt, versucht man seit längerem mit der Entwicklung des autonomen Fahrens entgegenzuwirken. Dass dies irgendwann fehlerfrei funktionieren wird, mag technisch realisierbar sein. Aber es ist idealtypisch gedacht. Es wäre nämlich naiv zu glauben, kriminelle Kreativität würde nicht auch diese Entwicklung korrumpieren und den Traum vom gefahrenlosen automatisierten Fahren zerstören können.
Übrigens, ebenso wie bekannte Autokonzerne hierzulande und anderswo das Rad zur Fortbewegung nicht erfunden haben, wurde autonomes Fahren schon Jahrhunderte vorher in der agrarischen Gesellschaft erfolgreich praktiziert: Pferdegespanne fanden eigenständig ihren Weg nach Hause, wenn ihre betrunkenen oder übermüdeten Lenker auf dem Kutschbock die Zügel schleifen ließen. Mancher stürzte dabei vom Bock und brach sich das Genick. Andere fielen skrupellosen Wegelagerern zum Opfer. Die Gefahren gingen also auch im analogen Zeitalter zumeist vom Menschen selbst aus.
MS
Vergänglich und treu: der Schneemann

„Juchhe, Schnee!“ mag manch einer gejauchzt haben, bevor im eben erst begonnenen Jahr nicht enden wollende Massen der weißen Himmelsgabe Straßen verstopft, Züge lahmgelegt, Dörfer abgeschnitten und den gesamten Alpenraum in ein Katastrophengebiet verwandelt haben. Der Winter zeigt sich heuer von einer düsteren Seite. Mit ein bisschen Phantasie lässt sich auch vom kuscheligen Sofa aus nachvollziehen, dass der Schnee, den heutzutage Wintersportler und Naturromantiker gleichermaßen herbeisehnen, in den Jahrhunderten ohne Elektrifizierung und Zentralheizung ein wahres Schreckgespenst war. Von wegen gute alte Zeit…
So war auch der Schneemann, heute niedliches Dekor auf Kindersocken oder Weihnachtspostkarten und beliebter Disney-Held, in seinen Anfangsjahren ein übler Geselle. Erste Abbildungen auf Kalenderblättern des 18. Jahrhunderts zeigen ihn mit grimmiger Miene, stechendem Blick und bedrohlicher Geste – wahrhaft zum Fürchten, wie die damals harte, oft lebensbedrohliche Winterzeit selbst.
Zum Freund der Kinder und Symbol unbeschwerter Winterfreuden wurde der Schneemann erst im 19. Jahrhundert. Aus der finsteren Gestalt entwickelte sich jener kugelige, gemütliche Geselle mit Rübennase, Kohlen- oder Knopfaugen und Kochtopfhut, der uns in schneereichen Wintern auch heute noch allerorten begegnet. Ganz im Sinne biedermeierlicher Familienvorstellungen gehörte er von da an als positiv besetzte Figur zum festen Repertoire von Winterdarstellungen in Kinder- und Hausbüchern. Befördert wurde seine Beliebtheit durch die populäre Druckgraphik des 19. und 20. Jahrhunderts, die Schneemann-Motive zu Weihnachten und Neujahr in die ganze Welt verbreitete. Kein Wunder, dass auch die Werbeindustrie bald das Potenzial des sympathischen Winterboten entdeckte. Weltanschaulich wie religiös unbesetzt lässt sich der Schneemann schließlich für vielerlei Botschaften einsetzen.
Dass das Internet aktuell eine Vielzahl detailreicher Bauanleitungen für Schneemänner bietet – bezeichnenderweise auf Seiten mit Titeln wie „familienleben“, „vaterfreuden“ oder „heimhelden“ – mag den ein oder anderen passionierten Schneemannbauer kränken. Denn ‚learning by doing‘ lautet die Devise. Es ist schließlich noch kein Schneemann-Baumeister vom Himmel gefallen.
Leider ist die Lebensdauer der weißen Gesellen in der Regel auf wenige kalte Tage und Nächte beschränkt. Wer dennoch nicht genug kriegen kann von Schneemännern, der markiere sich den 18. Januar im Kalender: den Welttag des Schneemanns. Und dann „Mein Kind, nun sag mir an, wer ist ein gemachter Mann?“
CLL
Öffentlicher Raum – was hängt schon dran?
Zum öffentlichen Raum haben heute hierzulande alle gleichberechtigt und uneingeschränkt Zugang. Er ist im Idealfall ein Ort, in dem sich die Menschen frei und friedlich begegnen. Als älteste und wohl mustergültigste Beispiele wären die Marktplätze zu nennen. Doch „Bewegungsfreiheit“ war lange Zeit etwas Exklusives und für Bevölkerungsgruppen wie Sklaven keine Selbstverständlichkeit.
Die Industrialisierung änderte die europäischen Gesellschaften und Städte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts grundlegend. Damit wandelt sich auch der Umgang mit dem öffentlichen Raum. Während sich das Großbürgertum in seinen luxuriösen Palais und Salons privilegierte Räume abseits vom Rest der Bevölkerung schafft, erschließen sich die in dicht besiedelten Quartieren lebenden Arbeiter aus der Not der beengten Wohnverhältnisse heraus ihre nähere Umgebung als Aufenthaltsort. Das Bürgertum zieht sich indes als Reaktion auf die als laut und chaotisch empfundene Städte in die familiäre Privatsphäre zurück.
Der schwelende Nationalismus in ganz Europa bestärkt die Herrschenden in dieser Zeit darin, die eigene Überlegenheit samt Machtanspruch im öffentlichen Raum der Städte zu repräsentieren und so zu unterstreichen. Dies schlägt sich in zahlreichen Monumenten, Prestigebauten, Amtssitzen, Museen oder Universitäten nieder, die prominente Plätze in den Städten einnehmen. Ihre repräsentativen Fassaden zeigen sich z. B. aufwändig mit Ornamenten geschmückt. Nach Ende des Ersten Weltkriegs hält die Verfassung der Weimarer Republik fest, dass der Staat Anteil an der „Pflege“ der Kunst nimmt. 1928 spricht die Regierung eine Empfehlung an die Länder aus, bei öffentlichen Bauvorhaben Künstler zu beteiligen. Diese Form der Förderung, die heute unter Kunst am Bau bekannt ist, dient während der Herrschaft der Nationalsozialisten der ideologischen Instrumentalisierung.
An der Förderpraxis stößt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielen sauer auf, dass städtische Bauverwaltungen – und nicht Kunstsachverständige – über Kunst entscheiden. Zudem wird kritisiert, dass die Kunst unumgänglich an die Architektur gebunden ist und somit lediglich als deren Ergänzung oder Beiwerk fungiert. In der Folge setzt ein Umdenken ein, das sich auch sprachlich niederschlägt: Es wird nun verstärkt von Kunst im öffentlichen Raum gesprochen. Auch in der Förderpraxis wird die Kritik aufgegriffen und die Unabhängigkeit der Kunst gestärkt. Seit Mitte der 1970er Jahre setzt es sich allmählich durch, dass Kunst im öffentlichen Raum unabhängig von Neubauten gefördert wird.
Das heutige Erscheinungsbild der Städte ist maßgeblich geprägt von der Vielzahl an Kunstwerken, die im Laufe der zurückliegenden Jahrzehnte entstanden sind. Diese Werke sind es wert, niederbayernweit erfasst zu werden. Deshalb dokumentiert das Kulturreferat auf seiner Homepage www.kunst-niederbayern.de die Informationen, die Kunstwerken im öffentlichen Raum – im Gegensatz zu solchen in Museen – in der Regel nicht beigegeben sind. Damit laden wir dazu ein, die direkte – und auch die weiter entfernte – Umgebung neu zu entdecken.
LS
Sagenhaft
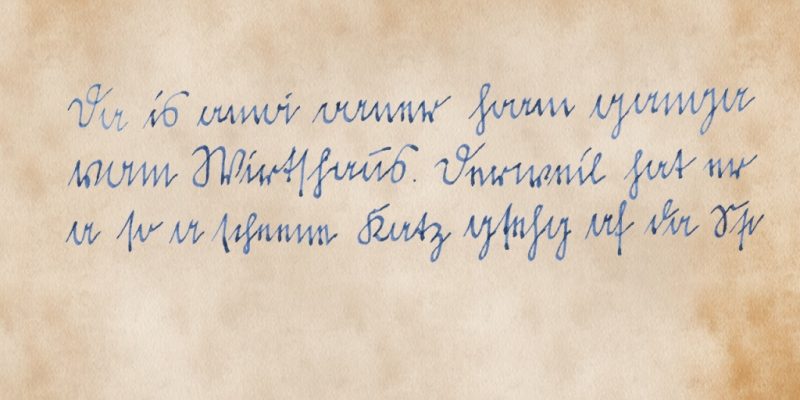
Heutzutage sind es Horrorfilme, Fantasy-Geschichten und Science-Fiction-Romane, welche Spannend-Schauriges bis Märchenhaftes erzählen und in mythische Welten entführen. So aufgeklärt sich unsere Gesellschaft auch wähnt, dem Faszinosum des Übernatürlichen kann sie sich kaum entziehen. Dies beweisen die zahlreichen Blockbuster und Bestseller stets aufs Neue. Vom künstlerischen Anspruch ihrer Urheber einmal abgesehen, sind es weniger pädagogische Absichten, die dazu motivieren. Es geht um kommerziellen Nervenkitzel. Letzterer bemisst sich nicht zuletzt in barer Münze.
Anders bei den überlieferten, teils dramatischen Volkssagen, die man sich nicht nur im Bayerischen Wald zu Hauf erzählte. Sie sollten ihren Zuhörern aus der alten Agrargesellschaft vor allem Respekt einflößen. Die Schilderungen wollten auf drastische Weise vor Augen führen, was mit Draufgängern, Querköpfen und Ungläubigen passierte, sobald sie die vorgegebenen Spielregeln der Dorfgemeinschaft oder gesetzte religiöse Normen missachteten: Im regional überlieferten Erzählgut werden sie von der „Wilden Jagd“ mitgenommen, versinken von geheimnisvollen Lichterscheinungen irregeleitet im Moor, oder es holt sie der Teufel höchst persönlich. Dieser hinterlässt zur ewigen Warnung an die Zurückgebliebenen gerne seinen tierischen Fußabdruck als quasi höllische Visitenkarte auf Ziegel- und Pflastersteinen.
Viele Menschen mögen in diesen Überlieferungen den skurrilen Aberglauben aus vergangener Zeit erblicken. Doch wer sich die Sagen der Moderne, die „urban legends“ ansieht, wie sie im Internet kursieren und sich über soziale Medien verbreiten, staunt darüber, was angeblich wahr sein soll, weil es zum Beispiel „der Mutter der Freundin einer Bekannten so und nicht anders widerfahren“ sei: Diese wollte während einer nächtlichen Heimfahrt durch ein abgelegenes Waldstück im Rückspiegel plötzlich eine Schwarze Frau in ihrem Auto gesehen haben. Erschrocken angesprochen, wer sie sei, verschwand die geheimnisvolle Gestalt. Am nächsten Tag entdeckte die Autofahrerin ein schwarzes Band auf dem Rücksitz. Man habe herausgefunden, dass es jenes Band war, das auf dem Grabkreuz einer jüngst verstorbenen Nachbarin fehlte.
Es sind immer dieselben alten Motive, die von Untoten und Dämonen, Zauberern und Helden handeln, und es gibt sie weltweit. Deshalb liefern auch die beiden Großgruppen, die historisch-mythischen und die dämonologischen Sagen, die besten Storys. Man denke an die 1995 verfilmte König Artus-Sage aus der Völkerwanderungszeit mit ihrer Starbesetzung Sean Connery (Artus), Richard Gere (Lanzelot) und Julia Ormond (Guinevere). Und wer kennt nicht den US-amerikanischen Thriller „The Devil’s Advocate“, in den Hauptrollen Keanu Reeves als Anwalt und Al Pacino als Teufel?
Unsere entzauberte moderne Welt, in der jedes Phänomen seine Erklärung findet, zeigt sich genau aus diesem Grund dem scheinbar Übernatürlichen und Phantastischen gegenüber aufgeschlossen. So wundert es nicht, dass man die alten Sagen, die seit den Tagen der Brüder Grimm gesammelt werden und ganze Bücherschränke füllen, immer wieder neu erzählt.
MS
Von der Tradition der Christkindlmärkte

An Christkindlmärkten mangelt es in Bayern nicht, und die städtischen Tourismusbüros überbieten sich dabei, deren Superlative anzupreisen: Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist der berühmteste, die Lindauer Hafenweihnacht wird als einzigartig bezeichnet und der Augsburger Christkindlesmarkt vor dem Renaissance-Rathaus beansprucht Einmaligkeit. Auch Niederbayern lässt sich nicht lumpen: Der Passauer Christkindlmarkt am Dom findet auf dem schönsten Platz nördlich der Alpen statt. Mit besonderer Weihnachtsromantik wirbt Straubing und lockt als die Krippenstadt Niederbayerns. Der Landshuter Christkindlmarkt in der Freyung wird als einer der schönsten in diesem vorweihnachtlichen Städteranking beworben.
Tatsächlich sind die traditionsreichen Weihnachtsmärkte ein städtisches Phänomen und beileibe kein ländliches oder ausschließlich bayerisches. Schließlich wird der Frankfurter Christkindchesmarkt bereits 1393 erwähnt, der Dresdner Striezelmarkt 1434, während der Nürnberger Christkindlmarkt erstmals 1628 abgehalten worden sein soll. Aber warum ausgerechnet städtisch, wo wir doch Traditionen und alte Bräuche so gern mit idyllischem Landleben verbinden?
Nun, ehedem ging es auf diesen Märkten nicht darum, eine übersättigte Gesellschaft wie die unsere in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. In vorindustrieller Zeit stand vielmehr die Bedarfsdeckung im Vordergrund. Begehrte Waren aus nah und fern konnten die Händler am besten in den einwohnerstarken Zentren anbieten, an den Knotenpunkten der eingeführten Handelsrouten. Hier lagen die Umschlagplätze, die auch die ländliche Bevölkerung aus der Umgebung zu den festgelegten Markttagen des Jahres aufsuchte. Gekauft wurden Dinge des Gebrauchs und solche, die man erst gar nicht zur Verfügung hatte, geschweige denn selbst herstellen konnte: Baumwolle, Seide, schöne Stoffe, Kleidung, Hüte, besondere Lederwaren, Schuhe, Geschirr, exotische Gewürze sowie feine Zelten der zünftigen Lebzeltner. Spielzeugmacher boten Holzspielzeug für die Kinder feil; im 19. Jahrhundert kamen Christbaumschmuck und Krippenzubehör aus Tirol und dem Erzgebirge hinzu. Auch der beliebte Passauer Holzmarkt in der Adventszeit lässt sich auf diese Tradition zurückführen.
Weihnachtsmärkte und -bazare, wie sie mittlerweile in kleineren Landgemeinden stattfinden, sind ein junges Phänomen. Mit örtlichen Traditionen lassen sie sich kaum begründen, aber das spielt keine Rolle. Inspiration holt man sich nicht aus Archiven; was ankommt, wird in die Tat umgesetzt. Meist gehen solche Veranstaltungen auf die Initiative kirchlicher Einrichtungen oder von Vereinen zurück. Angeboten werden neben Speisen und Getränken überwiegend Kunsthandwerkliches und Selbstgebasteltes. Der Erlös dient zumeist angesagten Spendenaktionen. Nicht der eigene Bedarf steht im Vordergrund, sondern das gemeinschaftliche Engagement und der gute Zweck. Beides ist sinnstiftend.
MS
Feuer und Flamme

Trotz LED-Beleuchtung und Lichterkette – in der Advents- und Weihnachtszeit gehört Kerzenlicht zum festen Repertoire festlicher Dekorationen. Aber auch beim Candle Light Dinner, einer Fackelwanderung oder am Kamin verbreiten Feuer und natürlich anmutende Lichtquellen wie Kerzen ihre ganz eigene Art von Licht und Wärme.
Aufgrund ihres hohen Preises waren (Bienen-)Wachskerzen lange Zeit allein dem Adel und der Kirche vorbehalten, Wachsspenden ein entsprechend kostspieliges Opfer reuiger Sünder. Die einfachen Leute beleuchteten ihre Häuser und Wohnungen mehr schlecht als recht mit rußenden Kienspänen und qualmenden Talglichtern. Erst die Entdeckung des Stearin als Kerzenrohstoff im Jahre 1818 und des Paraffinöls 1830 machte Kerzen erschwinglich und zur beliebten Massenware. Doch auch die Geschichte der Gasbeleuchtung von Straßenzügen und öffentlichen Gebäuden beginnt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weshalb Kerzenlicht für den Otto-Normal-Verbraucher seit jeher mit Privatsphäre und besonders feierlichen Anlässen in Verbindung steht.
Doch ob Kienspan, Kerze oder Kamin – die zentrale Frage seit Menschengedenken gilt der ‚Herstellung‘ von Feuer. Nicht umsonst gilt der Zeitpunkt, ab dem der Mensch selbst Feuer hervorbringen konnte, als Meilenstein der Evolution. Lange Zeit verstand man unter ‚Feuerzeug‘ daher auch kein handliches Gerät im Hosentaschenformat, sondern im Wortsinne jede Menge Zeug, mit dem man Funken erzeugen konnte: Feuerstein, Feuerbohrer, Feuerstahl, Zunder und dergleichen mehr. Einer kleinen Revolution kam es daher gleich, als ebenfalls Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten Zündhölzer eine sichere chemische Zündung ermöglichten. War das Hantieren mit jenen Tunkzündhölzern zunächst noch mühsam und nicht ganz ungefährlich, erfand der englische Apotheker John Walker 1826 das erste moderne Streichholz, das sich durch Reiben an einer rauen Oberfläche entzünden ließ. Stetige Weiterentwicklungen brachten nur wenige Jahre später die sogenannten Sicherheitszündhölzer hervor, deren schwedisches Patent sie auch hierzulande als „Schwedenhölzer“ bekannt machte. Bis 1983 bestand in der Bundesrepublik ein staatliches Zündwarenmonopol auf das im Alltag nahezu unverzichtbare Massenprodukt, dessen Herstellung, Verkauf und Preisbindung bis zum Aufkommen der Einweg-Feuerzeuge in den 1970er Jahren ansehnliche Gewinne abwarf.
Bunte Streichholzschachteln und -briefchen sind heute vor allem etwas für Nostalgiker und Sammler. Dabei stehen diese unscheinbaren Verpackungen auch für ein bedeutendes Kapitel der Industrie- und Kulturgeschichte, das auch in unsrer Region seine Spuren hinterlassen hat. Denn kaum bekannt und doch so naheliegend war auch der holzreiche bayerisch-böhmische Wald ein Produktionszentrum für Zündhölzer: Der Sägewerksbesitzer Johann Ellmann betrieb seit 1878 eine Zündholztunke in Grafenwiesen am Weißen Regen, die ein Landshuter Unternehmer nach 1900 zur Fabrik ausbaute. In ihrer Hochzeit in den 1950er Jahren beschäftigte die weithin bekannte Allmann AG rund 300 Arbeiter, vorwiegend Frauen. 1986 wurde die Zündholzproduktion eingestellt. Ihrer Geschichte kann man im ersten deutschen Zündholzmuseum in Grafenwiesen nachspüren.
CLL
Nikolaus und Weihnachtsmann

In den zurückliegenden Jahrzehnten fand ein regelrechter Verdrängungswettbewerb statt: Weihnachtsmann contra Nikolaus. Der schokoladene Beweis steht alljährlich bereits Monate vor dem Advent in den Regalen der Discounter. Dieses verfrühte Angebot ist für unsere Konsumgesellschaft selbstverständlich geworden. Längst bestimmt das Angebot die Nachfrage. Sobald kurz nach Weihnachten bereits die Osterhasen in die Regale drängen, kauft niemand mehr Weihnachtsmänner. Vom Nikolaus ist dann so oder so keine Rede mehr. Dessen Comeback immer am 6. Dezember ist allenfalls ein kurzes. Als Gabenbringer überlebt ihn der Weihnachtsmann saisonal ohnehin.
Beide Gestalten – Nikolaus und Weihnachtsmann – werden nur allzu gern verwechselt. Was unterscheidet sie also? Und wo kommen sie her?
Nun, wer etwas genauer hinschaut, erkennt den Unterschied: Der eine trägt eine rote Zipfelhaube und hält eine Rute in der Hand. Der andere ist mit Mitra und Stab ausgestattet, den Insignien eines Bischofs. Migranten sind sie beide: Der Ältere, der Heilige Nikolaus, lebte im 4. Jahrhundert und stammt aus Myra in der heutigen Türkei. Er wird unter anderem als Patron der Kinder und Gabenbringer verehrt. Der jüngere Weihnachtsmann taucht erst viele hundert Jahre später, nämlich im 19. Jahrhundert, auf. Als ursprünglich pfälzischer „Belznickel“ erhielt er von einem deutschen Karikaturisten und Amerikaauswanderer seine mittlerweile typische rote Robe mit den dicken weißen Pelzaufschlägen. In den 1930er-Jahren trat er schließlich mit der Coca-Cola-Werbung seine transatlantische Rückwanderung an und kehrte etwas verändert in die alte Heimat zurück.
Der seit langem in Bayern beheimatete „Nikolo“ weist sich zweifellos als Bischof aus. Als solcher unterhielt er von jeher enge verwandtschaftliche Beziehungen – etwa zum niederländischen Sinterklaas. Dieser war auch Patron von Neu Amsterdam, dem späteren New York. Nur nennen sie ihn dort Santa Claus. Ebenso gibt es einen russischen Bruder. Er heißt Deduschka Moros – Väterchen Frost. Wüsste man nicht um seine Herkunft, könnte man ihn glatt für einen waschechten Bayern halten. Denn er bevorzugt ein blau-weißes Kostüm. Allerdings symbolisieren seinen Farben nicht die bayerischen Rauten, sondern Kälte und Frost. Deswegen lässt sich Deduschka Moros sinnigerweise von seiner Enkelin Snegurotschka, dem Schneeflöckchen, begleiten.
Übrigens kennt Nikolaus als Patron der Kinder weder politische noch ethnische Grenzen. Als Père Noel beschenkt er französische Kinder ebenso wie er als Noel Baba mittlerweile auch Kinder islamischer Familien besucht. Er ist eben beides, ein echter Kinderfreund und Kosmopolit. Nur eines war er nicht – ein Weihnachtsmann, selbst wenn er dafür Pate stand.
MS
Die Esskastanie – Baum des Jahres 2018

Die Edel- oder Esskastanie (Castanea sativa) gehört zu den Buchengewächsen und ist eine uralte Kulturpflanze. Das älteste Exemplar steht in Sizilien an den Osthängen des Ätna – schon 1770 wurde dort ein Stammumfang von sage und schreibe 62 m (!) gemessen, heute haben die beiden verbliebenen Teile in 1 m Höhe immerhin noch einen Durchmesser von je 6 m und das Alter dieses Methusalems wird auf mindestens 2.000 bis 4.000 Jahre geschätzt. Die Baumart kommt ursprünglich aus Südeuropa, Westasien und Nordafrika, aber auch in Bayern gibt es vereinzelt prächtige Exemplare. So zum Beispiel in Landshut im Garten des heute privat genutzten Adelmannschlosses am Hofberg mit einem Stammumfang von 325 cm und einer Höhe von gut 20 Metern. Auch im Hofgarten und am Klausenberg finden sich weitere Esskastanien, die jedes Jahr von eingeweihten Spezialisten besucht werden. Denn sie hoffen, möglichst viele großfruchtige stachelbewährte Früchte zu ernten – die pro Nuss ein bis drei der äußerst kalorienreichen und schmackhaften glänzend rötlichbraune Früchte, die sogenannten Maroni enthalten.
Voll ausgewachsen kann die Baumart eine Höhe von 30 bis 35m und eine Breite von 20 bis 25 m erreichen. Die Blüten produzieren reichlich Nektar, werden sehr gerne von Hummeln, Bienen, Käfern und Fliegen besucht. In vielen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, England oder Teilen der Schweiz gab es richtige Kastanien-Niederwälder, v.a. zur Schweinemast oder zur Veredlung und Produktion kulinarischer Köstlichkeiten. Für die Verbreitung der Allzweckbaumart sorgten vor allem römische Soldaten und die Winzer für robuste Pfähle in den Weinbergen entlang von Rhein, Nahe, Mosel und Saar.
Im 17. Jahrhundert schrieb der englische Schriftsteller John Evelyn: „Eine Delikatesse für Fürsten und eine die Manneskraft hebende Speise für Landleute. Bei Frauen sorgt sie für eine gesunde Gesichtsfarbe.“ Maroni wurden und werden vielfach verarbeitet: neben der profanen Nutzung als Brennholz zu vor allem bei Allergikern zu sehr beliebtem glutenfreien Mehl, Brot und Frühstücksbrei oder als Geflügelfüllung, Gebäck und zu süßen Nachspeisen wie die berühmten „Marron glacés“ in Frankreich. Und schon bald erfreuen uns die zahlreichen Maronistände in den Innenstädten wieder mit ihrer heißen Ware, deren Duft unbedingt zur stimmungsvollen Adventszeit gehört.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die trockenheitsresistente Esskastanie in Zeiten des Klimawandels 2018 zum „Baum des Jahres“ gekürt wurde. Auch weil sie eine zukunftsfähige Alternative zu Tropenhölzern ist. Freuen wir uns, dass wir auch in Niederbayern noch ein paar prächtige Exemplare besitzen. Und schlaue Förster und kluge Waldbesitzer die Baumart künftig vermehrt pflanzen.
HW
Zwischen Denkmalpflege und Romantik 4.0: Verlassene Orte

Der ganze Globus ist dank GPS von einem Datennetz überzogen, das gefährliche Expeditionen und Abenteuer à la Robinson Crusoe schlechterdings unmöglich macht. Verschollen im Nirgendwo klingt wie ein Topos aus längst vergangener Zeit, selbst gesunkene U-Boote und vom Radar verschwundene Flugzeuge werden früher oder später aufgespürt. Die Welt scheint klein und überschaubar geworden.
Seit einigen Jahren durchzieht nun ein Trend das Land, der erkannt hat, dass die wahren Abenteuer nicht (nur) am anderen Ende der Welt, sondern vor der eigenen Haustüre zu finden sind: Urban Exploring (kurz Urbexing, im Deutschen weit profaner „Stadterkundung“) ist das Stichwort für den modernen Abenteurer. Vorwiegend junge Menschen erschließen sich so ihr alltägliches Lebensumfeld neu: Sie steigen in verlassene Hotels und Fabriken ein, erkunden Dachlandschaften und die Kanalisation. Wie bei den großen Pionieren vergangener Jahrhunderte ist natürlich auch hier das Ziel: Erster sein! Die Motivation liegt demgemäß wohl irgendwo zwischen sportlichem Ehrgeiz und kulturhistorischem Forscherdrang, zwischen Architekturerkundung und Action-Kunst. Denn die fotografische Dokumentation und Verbreitung derselben über Socialmedia-Kanäle ist selbstredend fester Bestandteil solcher Aktionen.
„Lost Places“ (ein Pseudo-Anglizismus, der sinngemäß „verlassene Orte“ meint) sind aber auch jenseits des modernen Stadtdschungels Ziel und Sehnsuchtsort für Erlebnishungrige und Entdecker. „Da Hogn“, das Online-Magazin aus dem Bayerischen Wald, hat vor einiger Zeit via Facebook dazu aufgerufen, „spannende und verlassene Orte im schönsten Bezirk Bayerns“ zu entdecken. Unzählige Fotos wurden seither hochgeladen, rund 18.000 Personen gefällt das. Eine Vielzahl ähnlicher Seiten dokumentiert stillgelegte Industriebauten, Fabriken und Militäranlagen, leer stehende Hotels und Schwimmbäder, verfallende Bauernhöfe und aufgelassene Dörfer auf der ganzen Welt – kurzum „die versteckte Schönheit des Verfalls“.
Bildmotive, die die Rückeroberung der von Menschen bebauten und genutzten Orte durch die Natur zeigen, sind zentrales Thema des noch jungen Genres Ruinen-Fotografie. Eine ideologische Nähe zur Romantik des 19. Jahrhunderts wird deutlich: Auch in den Werken von Caspar David Friedrich & Co sind Fernweh, der Reiz des Unheimlichen und die Hinwendung zur Vergangenheit bildgebende Motive.
Während die einen ihre kleinen privaten Fluchten vor der lauten Welt an stille, unentdeckte Phantasy-Schauplätze mit der Online-Community teilen, stellen andere ihre „Forschungsarbeit“ offiziell in den Dienst des Denkmalschutzes. Für die Dokumentation verfallener, (nicht-)denkmalgeschützter Bauwerke wurde 2017 „rottenplaces – Magazin rund um verfallene Bauwerke, Denkmalschutz & Industriekultur“ mit dem Internetpreis des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz ausgezeichnet.
Der wahre Sinn und Nutzen dieser Form von Ortserkundungen liegt wohl irgendwo zwischen Denkmalpflege und Romantik 4.0 – sofern man sich an den Ehrenkodex der „Urbexer“ hält: Nur schauen, nicht anfassen! Und das nicht nur, weil die Unberührtheit des Ortes für andere Entdecker erhalten bleiben soll, sondern weil man sich beim Betreten verlassener Liegenschaften immer auch in einer Gefahren- und rechtlichen Grauzone befindet.
CLL
Wie ticken die Bayern?

Der Wunsch, zu wissen, wie Menschen in bestimmten Regionen denken und handeln, ist nicht neu. Schon der Wittelsbacher König Max II. wollte sich ein möglichst genaues Bild seiner Untertanen machen, um sie und ihre sozialen Verhältnisse besser zu verstehen. Ausgehend von diesem Wissen wollte er unter anderem Reformen anstoßen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern und sie damit auch als ökonomische Ressource für das Königreich fördern. Zur Informationsgewinnung ordnete er den bayerischen Amtsärzten an, sogenannte Physikatsberichte zu erstellen. In ihnen wurden allerlei Informationen zur Gesundheit und Landschaft gesammelt sowie die Mentalität der Bevölkerung des jeweiligen Bezirks ausführlich beschrieben. Der Rückgriff auf allerlei Stereotype und Klischees, die über Jahrhunderte gewachsen sind, war hierbei durchaus auch gang und gäbe. Schwaben sind beispielsweise sparsam, reinlich und aufgeschlossen für Neues. Franken verfügen über ausgezeichnete intellektuelle Fähigkeiten, sind aber unreinlich. Oberbayern sind rückständig, antriebslos, gemächlich, unreinlich und nicht aufgeschlossen für Neues. Zudem wird auf ihren Hang zum Raufen und Saufen hingewiesen. So schön eindeutig kann die Welt sein…
Die Mentalität, ja, das Wesen der Menschen wollten hauptberufliche und selbstberufene Ethnografen im Laufe der Zeit immer wieder erfassen. Schon der römische Senator und Historiker Tacitus beschrieb den „edlen Wilden“ Germaniens. Und wie anders liest sich beispielsweise die Kurzcharakterisierung der Oberbayern durch Kurt Huber, die dieser in seinem niederbayerischen Liederbuch von 1939 niedergeschrieben hat. Hier heißt es, dass die Niederbayern „kein besonders zugänglicher Menschenschlag“ sind und „nichts von der heiteren Aufgeschlossenheit“ der Oberbayern haben. So schafft sich jeder sein eigenes Bild der unterschiedlichen „Stämme“.
Dieses Bild verrät oftmals mindestens ebenso viel über die Befragten und/oder Beobachteten wie über die Befragenden und Beobachtenden und Ihr Erkenntnisinteresse. Warum hat sich denn Tacitus so genau mit den Germanen befasst? Sein Interesse lag womöglich in der Absicht begründet, die Verkommenheit der eigenen Gesellschaft anhand eines positiven Gegenbeispiels zu kritisieren und diese so zur Besserung anzutreiben.
Gemein ist den ethnografischen Erfassungen der Mentalitäten somit, dass die Verfasserinnen und Verfasser durch sie automatisch mehr oder weniger stark Wirklichkeit gemäß der eigenen Prägung erfinden.
Die alte Absicht, Regionen hinsichtlich ihrer mentalen Verfassung zu kartieren, hat auch eine kürzlich veröffentlichte Persönlichkeitsstudie von Wirtschaftswissenschaftlern und Psychologen der Universität Jena verfolgt. Sie reklamiert für sich, durch empirische Erhebungen zu objektiven Ergebnissen gekommen zu sein. Bemerkenswert ist hieran, dass trotz anderer Vorgehensweise das Ergebnis gleich geblieben ist, da durch sie beispielsweise die Stereotypen vom geselligen Bayern und unterkühlten Norddeutschen bestätigt werden. Inwieweit man ihnen zustimmt oder widerspricht, kann jeder für sich selbst herausfinden.
LS