Wie ticken die Bayern?

Der Wunsch, zu wissen, wie Menschen in bestimmten Regionen denken und handeln, ist nicht neu. Schon der Wittelsbacher König Max II. wollte sich ein möglichst genaues Bild seiner Untertanen machen, um sie und ihre sozialen Verhältnisse besser zu verstehen. Ausgehend von diesem Wissen wollte er unter anderem Reformen anstoßen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern und sie damit auch als ökonomische Ressource für das Königreich fördern. Zur Informationsgewinnung ordnete er den bayerischen Amtsärzten an, sogenannte Physikatsberichte zu erstellen. In ihnen wurden allerlei Informationen zur Gesundheit und Landschaft gesammelt sowie die Mentalität der Bevölkerung des jeweiligen Bezirks ausführlich beschrieben. Der Rückgriff auf allerlei Stereotype und Klischees, die über Jahrhunderte gewachsen sind, war hierbei durchaus auch gang und gäbe. Schwaben sind beispielsweise sparsam, reinlich und aufgeschlossen für Neues. Franken verfügen über ausgezeichnete intellektuelle Fähigkeiten, sind aber unreinlich. Oberbayern sind rückständig, antriebslos, gemächlich, unreinlich und nicht aufgeschlossen für Neues. Zudem wird auf ihren Hang zum Raufen und Saufen hingewiesen. So schön eindeutig kann die Welt sein…
Die Mentalität, ja, das Wesen der Menschen wollten hauptberufliche und selbstberufene Ethnografen im Laufe der Zeit immer wieder erfassen. Schon der römische Senator und Historiker Tacitus beschrieb den „edlen Wilden“ Germaniens. Und wie anders liest sich beispielsweise die Kurzcharakterisierung der Oberbayern durch Kurt Huber, die dieser in seinem niederbayerischen Liederbuch von 1939 niedergeschrieben hat. Hier heißt es, dass die Niederbayern „kein besonders zugänglicher Menschenschlag“ sind und „nichts von der heiteren Aufgeschlossenheit“ der Oberbayern haben. So schafft sich jeder sein eigenes Bild der unterschiedlichen „Stämme“.
Dieses Bild verrät oftmals mindestens ebenso viel über die Befragten und/oder Beobachteten wie über die Befragenden und Beobachtenden und Ihr Erkenntnisinteresse. Warum hat sich denn Tacitus so genau mit den Germanen befasst? Sein Interesse lag womöglich in der Absicht begründet, die Verkommenheit der eigenen Gesellschaft anhand eines positiven Gegenbeispiels zu kritisieren und diese so zur Besserung anzutreiben.
Gemein ist den ethnografischen Erfassungen der Mentalitäten somit, dass die Verfasserinnen und Verfasser durch sie automatisch mehr oder weniger stark Wirklichkeit gemäß der eigenen Prägung erfinden.
Die alte Absicht, Regionen hinsichtlich ihrer mentalen Verfassung zu kartieren, hat auch eine kürzlich veröffentlichte Persönlichkeitsstudie von Wirtschaftswissenschaftlern und Psychologen der Universität Jena verfolgt. Sie reklamiert für sich, durch empirische Erhebungen zu objektiven Ergebnissen gekommen zu sein. Bemerkenswert ist hieran, dass trotz anderer Vorgehensweise das Ergebnis gleich geblieben ist, da durch sie beispielsweise die Stereotypen vom geselligen Bayern und unterkühlten Norddeutschen bestätigt werden. Inwieweit man ihnen zustimmt oder widerspricht, kann jeder für sich selbst herausfinden.
LS
Heimat in bewegten Zeiten

Heimat ist für die Menschen in mehrfacher Hinsicht wichtig. Sie besitzt soziale, geographische, kulturelle, wirtschaftliche und politische Bedeutung. Seit einigen Jahren hat Heimat eine Renaissance erfahren. Doch das war nicht immer so.
Im Nachkriegsdeutschland war das Thema belastet. Der Grund ist in der deutschen Geschichte zu finden. Die Machthaber des Dritten Reichs missbrauchten den Heimatbegriff im Sinne ihrer Blut-und-Boden-Ideologie. Aus seiner territorialen Deutung sprach jener Revanchismus, der in einen Krieg mit verheerenden Ausmaßen mündete. Kulturpolitisch erhielt das Wort Heimat seine chauvinistische Aufladung. Sie gipfelte in einer nationalistischen Kultur- und Volkstumspflege mit der Überhöhung des „Arteigenen“, des „Bodenständigen“ einerseits und aggressiven Abwertung des „Fremden“, des „Internationalen“ andererseits. Dies alles wirkte nach. Der Begriff Heimat war für lange Zeit negativ besetzt.
Die nationale und internationale wissenschaftliche Analyse – die historische wie kulturelle – beanspruchte Jahrzehnte zur Aufarbeitung des Ballasts.
Landesweite, regionale und lokale heimatpflegerische Aktivitäten, wie etwa die Trachten- oder Volksmusikpflege, hatten erhebliche Mühe, die Hinterlassenschaften und den Zungenschlag brauner Volkstumspolitik zu neutralisieren. Die Literatur begegnete dem Problem auf unterschiedliche Weise: Während vor allem Dialektlyriker ab den 1970er-Jahren offensiv neue Töne anschlugen und Heimat kritisch in den Blick nahmen, schrieben sich Mundartdichter in nostalgischen Reimereien über die jüngere Vergangenheit hinweg. Der kulturelle Wandel bahnte sich dennoch seinen Weg, weiland die heimatpflegerischen Flügel darüber stritten. In den Neunzigern musste sich die kulturpessimistische Volksmusikpflege unfreiwillig von stilistischen Entwicklungen wie „Tradimix“ und der Neuen Volksmusik überrollen lassen. Sie waren die Vorreiter für den „Heimatsound“ des jungen Jahrtausends. Etwa zeitgleich entdeckte die bayerische Jugend Dirndl und Lederhose als Volkfest- und Party-Outfit, manches Wirtshaus wurde wie schon Jahrzehnte zuvor auf Heustadel getrimmt. Medien und Politik stilisieren solche Trends gern zum neuen Heimatgefühl. Aber als Reaktion auf die Globalisierung zeigt die Hinwendung zur Heimat durchaus bedeutendere Facetten, z. B. die neue Wertschätzung des Regionalen in Form von regionaler Nahrungsmittelproduktion, Direktvermarktung und einheimischen Handwerkserzeugnissen. Übrigens, schon lange vor den Heimatvergnügungen und Versatzheimaten brachte sich eine politisch unbequeme Art der Heimatverbundenheit ein: Das bürgerschaftliche Engagement und der Protest, wo Großbauprojekte und Flächenfraß heimatliche Kulturlandschaften zu beeinträchtigen drohen. Das erkämpfte oberpfälzische Wackersdorf ohne Wiederaufbereitungsanlage ebenso wie der erstrittene niederbayerische Donauabschnitt ohne Staustufen haben der Landespolitik die Stärke eines substantielleren Heimatverständnisses aufgezeigt.
Im Kontext der Flüchtlingskrise und Migrationsbewegungen ist Heimat abermals als brisantes Thema hochgekocht – auf nationalem wie internationalem Parkett und aus Perspektiven, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Dem Verlust von Heimat auf der einen Seite steht die Sorge um Heimat auf der anderen gegenüber. Heimat bleibt also eine ständige Herausforderung – erst recht in bewegten Zeiten, welche die Menschen beunruhigen. Freilich geht Heimat zuerst jede/n selbst an – vor Ort. Doch gehen viele Menschen nicht zuletzt auch deshalb wählen, weil sie sich bei den großen Fragen und Problemen allemal Antworten und Lösungskonzepte von ihren politischen Repräsentanten erwarten. Dabei sollte man aus der Geschichte gelernt haben, welche Ideologien ehedem ins Verderben führten.
MS
„Da Tod g’hört zum Leb’n…“

Der Tod gehört zum Leben – und das ist totsicher. Jedes Jahr auf’s Neue erinnert der „Totenmonat“ November rund um Allerheiligen und Allerseelen an die Endlichkeit allen irdischen Daseins. Dabei begegnet jeder dem Tod auf seine Weise – ängstlich, verdrängend, ehrfürchtig, bisweilen sogar freundlich. Ja, es scheint, als hätte man gerade im bairischen Raum ein ganz besonderes Verhältnis zum „Boandlkramer“, wie der Tod hierzulande nicht erst seit Franz von Kobells Erzählung „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ augenzwinkernd genannt wird.
Gerade für Menschen aus bäuerlich geprägten Landschaften, die jahraus, jahrein das Werden und Vergehen in der Natur miterleben und mitgestalten, ist es selbstverständlich, dass zu einem guten Leben zu guter Letzt auch ein gutes Sterben gehören muss. Das mag nicht zuletzt an einer treuherzigen, zuweilen biederen Frömmigkeit und dem unerschütterlichen Vertrauen zur christ-katholischen Kirche liegen – einem Charakterzug, der in den letzten Jahren deutlich im Verschwinden begriffen ist. Geblieben aber ist vielen der Galgenhumor, mit dem Leben und Sterben hingenommen werden. „Derb zugreifende altbayerische Lebensfreude, aufgeweckter Sinn, schlagfertiger Witz und eine Fülle von Talenten“ (aus Ludwig Thoma: „Erinnerungen“) haben dazu beigetragen, dass eine Fülle von Redensarten über das Sterben und den Tod entstanden ist und dass diese bis auf den heutigen Tag im Volksmund fortleben.
Gern wird der Tod dabei personifiziert, denn als redseliger Boandlkramer, Ripperlhans oder Brettlrutscher verliert er eher seinen Schrecken. „Da Tod hat vui Nama“ – und er hat viele Gesichter. Als Totengräber, als Skelett mit Sanduhr und Sense, als Reiter mit dem Schwert, als Nackter mit Leichentuch und anderen Vanitas-Symbolen wie einer erloschenen Kerze oder geknickten Ähren, tritt er uns in zahlreichen Darstellungen gegenüber. „Da Tod z’Eding“ ist in seiner dürren, bleichen Gestalt sprichwörtlich geworden und dabei mit seiner drohend geschwungenen Sense weit entfernt vom vertrauensvollen Bild des Boandlkramers, dem mit Witz und ausreichend Kirschgeist noch das ein oder andere Lebensjahr abzutrotzen ist.
Wenn man in Wahrheit auch nicht mit dem Tod handeln kann, so scheint er doch gerecht zu sein: Er hebt alle Ungleichheiten auf, Arm und Reich trifft er gleichermaßen. Die mittelalterlichen Totentanz-Darstellungen – wie zum Beispiel in St. Peter zu Straubing – zeigen den „ewigen Gleichmacher“ als Spielmann mit Fiedel, Pfeife, Laute oder Dudelsack, der mit Menschen jeden Alters und Standes unerbittlich den Reigen hinüber in die andere Welt tanzt.
Weil der Volksglaube vor der ewigen Glückseligkeit „drüben“ noch das verzehrende Fegfeuer fürchtet, hat man Hilfe ersonnen: Mit guten Taten im Diesseits soll das Purgatorium im Jenseits erträglich und verkürzt werden. „Seelwecken“ oder „Seelbroten“ wurden an Kinder und Arme verschenkt. „Helf dir Gott!” sagte man einem Niesenden und der erwiderte mit einem “Vergelt’s Gott für die Armen Seelen.” Diese Dankesformel von der Qualität eines kleinen Ablasses sprachen auch jene, die beschenkt wurden. Ebenso versprach man sich vom Besprengen der sogenannten Allerseelentaferl mit Weihwasser eine Kühlung für die Seelen im Fegfeuer.
Zeugnisse tiefer Frömmigkeit liefern auch die Totenbretter des Bayerischen Waldes, die noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts an Häusern, Friedhofsmauern und Weggabelungen zu sehen waren. Sie hatten, solange das Aufbahren der Verstorbenen im Haus noch üblich war, als Bahrbrett gedient oder erinnerten als Gedenkbrett an den, „der über’s Brettl oweg’rutscht“ war. Bemalt und mit einer Inschrift oder holprigen Reimen versehen hat man sie im Freien aufgestellt. Dabei waren die Sprüche nicht immer besinnlich und zeugten oft mehr von besagtem humorvollen Umgang mit dem Tod, als von ängstlicher Ehrfurcht oder mit Karl Valentin gesprochen: „Da hab ich a Leben lang Angst vorm Sterb’n g’habt, und jetz’ des!“
CLL
Erinnern und gedenken

Auf dem Friedhof des Bezirksklinikums Mainkofen wurde am 28. Oktober 2014 eine Gedenkstätte eingeweiht. Sie gilt den Opfern der Psychiatrie im Nationalsozialismus. Damit hatte der Bezirk Niederbayern in Mainkofen ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die öffentlich sichtbare Erinnerung an jene Patienten, die der Nationalsozialistische Staat ihrer Behinderung oder psychischen Erkrankung wegen für „erbbiologisch und gesellschaftlich minderwertig“ erklärt hatte. Durch verbrecherische Anordnungen wurden sie ihrer Würde und viele ihres Lebens beraubt.
Am 1. Januar 1934 trat das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft. Infolgedessen wurden in der Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen bis 1943 mehr als 500 Jugendliche und Erwachsene zwangssterilisiert. 1939 begann unter den zynischen Bezeichnungen „Euthanasie“ und „Aktion Gnadentod“ der Massenmord an Anstalts- und Heimbewohnern. Die erste Phase der planmäßig durchgeführten Tötungen wurde als „Aktion T 4“ bezeichnet – benannt nach dem Sitz der Organisationszentrale „Tiergartenstrasse 4, Berlin“. Psychiatrische Anstalten wie Mainkofen mussten ihre Patienten nach Berlin melden. Dort entschieden Gutachter, wer in eine der sechs reichsweit eingerichteten Gastötungsanlagen deportiert wurde. Aus Mainkofen verlegte man zwischen Oktober 1940 und Juli 1941 über 600 Patienten in die Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz. Dort fanden die Opfer ihren Tod in der Gaskammer. Nachdem sich die Vernichtungstransporte auf Dauer nicht verheimlichen ließen, wurde die „geheime Reichssache T 4“ im August 1941 eingestellt.
Es folgte die zweite Phase der „Euthanasie“: In den Anstalten und Heimen wurde nun durch Überdosierung von Medikamenten, Nichtbehandlung von Krankheiten, Kälte und Hunger getötet. In Mainkofen kam der „Bayrische Hungerkost-Erlass“ vom November 1942 mit der so genannten „3b-Kost“ zur Anwendung. Dies war eine fleisch- und fettlose Ernährung, die in wenigen Monaten zum schleichenden Tod durch Entkräftung führte. Fast 800 Mainkofener Patienten starben deswegen an Unterernährung.
Jüngeren Erhebungen zufolge wurden während des Nationalsozialismus bis zu 300.000 Menschen in deutschen Psychiatrien ermordet. In dieser Zeit schrieb auch das heutige Bezirksklinikum Mainkofen das dunkelste Kapitel seiner über 100-jährigen Geschichte. Dieses Kapitel wird nicht mehr tabuisiert, sondern in seinen einzelnen Phasen in einer würdevoll gestalteten Gedenkstätte thematisiert. Seit 2014 begeht der Bezirk Niederbayern jeweils am 28. Oktober, dem Jahrtag des ersten „T 4-Transports“ eine Feier zur Erinnerung an die Opfer.
Das macht die Verbrechen nicht ungeschehen, aber man stellt sich seiner Geschichte.
MS
Kultur digital vermitteln – Chancen und Strategien

Die Digitalisierung verändert zunehmend nicht nur Handel, Industrie und Verwaltung, sondern konfrontiert auch Kultureinrichtungen mit neuen Aufgaben und Möglichkeiten. War vor zehn Jahren die Homepage noch der digitale Standard, so sind in den zurückliegenden Jahren viele weitere digitale Haupt- und Nebenwege entstanden, die Aufgabenfelder der Dokumentation, Kommunikation und Vermittlung berühren und verändern. Um sich diesen komplexen Aufgaben stellen zu können, planen zunehmend mehr Kultureinrichtungen ganzheitliche Strategien: dabei werden unterschiedliche digitale Kanäle, Inhalte und Erzeugnisse nicht mehr als Insellösungen betrieben, sondern strategisch entwickelt und aufeinander abgestimmt. Der entstehende Mehrwert schärft den Blick und die Entscheidungskompetenz für das Digitale. Neue zielgruppenorientierte inhaltliche Angebote können noch präziser und professioneller umgesetzt, Synergien zu ähnlichen Prozessen im Tourismus und Verwaltung genutzt werden. „Digitale Medien können die Idee des Museums verstärken und das dort angehäufte Wissen viel breiter zur Verfügung stellen“ schreibt Volker Rodekamp, vormals Präsident des Deutschen Museumsbundes.
Eine Tagung im Oberhausmuseum Passau
Welche Möglichkeiten haben kleine und mittelgroße Kultureinrichtungen (Museen, Archive, Bibliotheken, Vereine, etc.) Kulturarbeit im digitalen Raum zu betreiben? Was ist heute sinnvoll, was ist notwendig? Wieviel Sichtbarkeit und Reichweite sind nötig um „relevant“ zu bleiben? Was kann ein kleiner Betrieb überhaupt leisten? Welche Ressourcen sind erforderlich und wo bieten sich digitale Partnerschaften an?
Diese Fragen und weitere Themen stehen am 15.11.2018 im Fokus einer Tagung im Oberhausmuseum Passau. Ziel der Tagung ist nicht nur eine Vorstellung von „digitalen Strategien“, sondern auch der gemeinsame offene Austausch über aktuelle Fragen und Problemstellungen zu Website, Socialmedia und Digitalisierung. Veranstalter sind die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, der Bezirk Niederbayern/Kulturreferat und die Stadt Passau/Oberhausmuseum.
ChG
Erdwerk Altheim

Kulturbeflissene bewundern weltweit berühmte Kunstwerke, Touristen besichtigen imposante Bauwerke, unsere Gesellschaft schätzt qualifiziertes Handwerk, der Landwirt bemisst seine Flächen in Tagwerk, Wirtschaft und Politik pflegen Netzwerke, unsere Energie liefern Kraftwerke. Mit all diesen „Werk“-Begriffen wissen wir etwas anzufangen. Sie sind Ergebnisse unserer geistigen wie manuellen Fähigkeiten, und sie zählen zum sprachlichen Allgemeingut.
Anders ist dies bei Fachbegriffen, die bestimmten Berufen, Tätigkeiten und Fachgebieten erwachsen. Wer weiß zum Beispiel, was ein „Erdwerk“ ist und was es damit auf sich hat? Hierbei handelt sich um einen Fachbegriff aus der Archäologie, also jener wissenschaftlichen Disziplin, welche die Vor- und Frühzeit erforscht und die frühe Menschheits- und Kulturgeschichte zu erhellen sucht.
Als „Erdwerk“ bezeichnen die Archäologen ein Bodendenkmal aus ringförmig angeordneten Gräben und Wällen. Meist enthalten solche Anlagen Einbauten aus Holz und Stein. Diese Bauwerke erfüllten verschiedene Zwecke. Sie dienten als Dorf-Befestigungen, kultische Versammlungsorte, Fluchtburgen, Begräbnisstätten und als sogenannte Kalenderbauten, welche die Beobachtung der Tag- und Nachtgleiche, der Sonnen- und Mondwenden ermöglichten. Erdwerke wurden in der Jungsteinzeit (Neolithikum) angelegt. Sie zählen zu den eindrucksvollsten Monumenten des vierten vorchristlichen Jahrtausends, also jener Epoche der Geschichte, die den Übergang von der Jäger- und Sammlerkultur zum sesshaften Bauerntum mit domestizierten Tieren und kultivierten Pflanzen markiert.
Man findet Erdwerke über den gesamten mitteleuropäischen Raum verstreut. Eine klassische Stätte dieser mitteleuropäischen Jungsteinzeit ist Altheim bei Landshut. Hier wurden bereits 1911 zwei räumlich aufeinander bezogene Grabenanlagen entdeckt, die auf das Zusammenleben und die Leistungsfähigkeit eines größeren Siedlungsverbandes während des 37./36. Jahrhunderts v. Chr. hinweisen. Dies bestätigten eine erste archäologische Grabung im Jahr 1914 und eine weitere von 1938. Die beiden Anlagen mit ihrem reichhaltigen Fundmaterial sind die namengebenden Fundstellen der sogenannten „Altheimer Kultur“, die sich vor allem durch ihre typische Keramik, nämlich unverzierte Gefäße mit Fingertupfen- bzw. Arkadenrandleisten, auszeichnet.
Übers Jahr wird man weiterforschen. Man darf also auf neue Erkenntnisse hoffen, insbesondere auch aufgrund der modernen Untersuchungs- und Analysemethoden, die heutzutage zum Einsatz kommen. Es bleibt also spannend, was das Erdwerk Altheim über unsere Ur-Vorfahren noch alles zu erzählen hat.
MS
Bild: Landkreis Landshut/Kreisarchäologie
Totensuppe für ein Waldlerhaus

Der Bayerische Wald war immer eine arme Gegend. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Begriff „Waldlerhaus“ von den wohlhabenden Bewohnern der fruchtbaren Donauebene geprägt wurde und einen etwas abschätzigen Beigeschmack hat. Später wurde die Bezeichnung vom Tourismus in Dienst genommen und von romantischen Stadtbewohnern zur Idylle stilisiert, die der Inbegriff geworden ist für das Landleben und die gar nicht immer so gute alte Zeit. Feststellen lässt sich aber: in gleichem Maße, wie die Waldlerhäuser aus der Landschaft verschwanden und durch gesichtslose Neubauten ersetzt wurden, stieg die Begeisterung, ja Verklärung für das Leben auf dem Land.
Das Waldlerhaus als Sehnsuchtsort
Es waren die „Stadterer“, die schon in den 1960er Jahren für die Waldlerhäuser schwärmten und begannen, sie zu kaufen und zu restaurieren, um sie als Ferienwohnhaus zu nutzen. Künstler und Architekten interessierten sich für die alten Gebäude mit ihrem ländlichen Charme. Nun setzt langsam ein Umdenken ein, weg von der Kuschelfolklore und hin zu der Erkenntnis, dass in der Kombination von Tradition und zeitgemäßem Denken Potential für die Zukunft liegt.
Das Imannhaus am Dreisessel und ein Fotoprojekt
Als Gertraud Platschek und ihr Mann Hansjörg 2007 das verfallende Waldlerhaus am Dreisessel entdeckten, war es Liebe auf den ersten Blick. Die gelernte Architektin erfüllte sich mit dem Wiederaufbau des Imannhauses in Schimmelbach einen Lebenstraum: ein organisch in die Landschaft eingefügtes Haus wieder zum Leben zu erwecken, seine Geschichte sichtbar werden zu lassen und die alten Räume aus Granit und Holz zu einem Haus für die ganze Familie zu machen. 2010 wurde ihr Engagement mit dem Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern belohnt.
Im Zuge ihrer Erforschung der Waldlerhäuser im Dreiländereck begann Gertraud Platschek, die Häuser systematisch zu fotografieren und engagierte sich für diese „Erinnerungsorte des bäuerlichen Lebens im Bayerischen Wald“. Dabei stieß sie nicht immer auf Wohlwollen; so mancher Besitzer war misstrauisch gegenüber der Künstlerin aus München und als wir im vergangenen Sommer gemeinsam unterwegs waren, um einige der Häuser anzusehen, wurden wir schon mal vom Hof gejagt. Die Skepsis gegenüber Fremden ist groß, ebenso wie die Angst vor dem Denkmalschutz.
Die Installation Unholdenberg – ein Kreuzweg in vierzehn Stationen
Auf ihren Erkundungsfahrten im Bayerischen Wald stieß Gertraud Platschek auf das seit Jahrzehnten verlassene Waldlerhaus in Unholdenberg bei Waldkirchen. Das einst stattliche zweistöckige Bauernhaus aus dem Jahr 1876 in der Dorfmitte war am Verfallen. Kein Liebhaber fand sich für den zweistöckigen Granitbau mit verschindelter Holz-Giebelwand, für die Stube mit der Tramdecke und den Eckfenstern, für die gewendelte Treppe aus Granitblöcken, die mit großen, ausgetretenen Granitplatten ausgelegte Fletz und den Stadl. Schließlich wurde das Anwesen abgerissen. Doch die Geschichte beschäftigte Gertraud Platschek nachhaltig. Gemeinsam mit ihrer Künstlerfreundin Carola Ludwig wollte sie dem Haus eine letzte Ehre erweisen. Auf dem ehrwürdigen Dachboden des sanierten Imannhauses bauten die beiden mit Relikten aus dem Abrisshaus die Installation „Unholdenberg“, die sie allen untergehenden Waldlerhäusern widmeten. Damit wird die Erinnerung an das Leben der Bewohner und ihre vergangene Welt aufrechterhalten.
IK
Kunst für mündige Bürger

130.000 bildende Künstler gibt es in Deutschland. Ihren Traum, von ihrer Kunst angemessen und würdevoll leben zu können, können nur wenige verwirklichen. Notgedrungen sind sie also auch Lebenskünstler oder verdienen ihr Geld mit einem Zweitberuf, um ihr Grundeinkommen zu sichern. In einer Statistik von 2016 gibt die Künstlersozialkasse KSK das durchschnittliche Jahreseinkommen von männlichen Künstlern mit 18.121 EUR an, Künstlerinnen sind mit 13.268 EUR noch schlechter gestellt. Zum Leben reicht es kaum. Berufsverbände schaffen etwas Abhilfe und bemühen sich um Wettbewerbsausschreibungen, Kunst am Bau, Zugang zu sozialer Sicherung, Ausstellungsmöglichkeiten und -vergütungen. Kommunen setzen auf öffentliche Ankäufe, Kunstvereine, Museen und Galerien bieten Ausstellungsmöglichkeiten.
Der Bezirk Niederbayern bringt mit dem Aktionstag „Ateliers in Niederbayern“ regelmäßig Künstler und Bevölkerung zusammen: Das Projekt lädt zum Tag der offenen Tür in zahlreichen Künstlerwerkstätten ein. Zwischen 160 und 180 Ateliers aus der Region sind jeweils geöffnet – eine Zahl, die für eine ansehnliche Künstlerdichte in Niederbayern spricht. Spannend ist es, dabei ganz unterschiedliche Werkräume zu besuchen: Ein ausgebauter Stadel, ein ehemaliger Supermarkt, der heimische Küchentisch oder die Kellerwerkstatt – sie alle können Atelier sein. Darin eröffnen sich neue Welten: Neben auch dem Laien bekannten Arbeitsbereichen wie Malerei, Bildhauerei oder Zeichnung präsentieren sich auch digitale Kunst, Glasobjekte, Installationen, Textilobjekte, Video- und Recyclingkunst. Wer genau wissen möchte, wie eigentlich eine Bronzeskulptur entsteht oder Gold- und Silberobjekte geformt werden, kann seinen Fragen im persönlichen Gespräch mit den Künstlern nachgehen. Sie erklären Ideen, Werkstoffe und Arbeitsgerätschaften und veranschaulichen den Entstehungsprozess ihrer Werke mithilfe von Skizzen und Entwürfen.
Wer nun unter dem Sinn und Zweck eines solchen Tags der offenen Tür lediglich ein unterhaltsames Programm mit bunten Bildern versteht, irrt gewaltig. Denn Bildende Kunst erfüllt einen äußerst sinnvollen gesellschaftlichen Zweck: Sie bildet mündige Bürger aus. Kunst muss nämlich nicht schön sein. Sie lädt vielmehr zur Meinungsbildung ein. Da zeitgenössische Kunst nicht der Allgemeingültigkeit verpflichtet ist, sondern sich gerne eine subjektive Perspektive erlaubt, die irritierend oder provokant sein kann, lädt sie den Betrachter dazu ein, sich selbst zu positionieren – ethisch wie ästhetisch, inhaltlich wie politisch.
Darauf darf man sich getrost einlassen und das eigene Kunstverständnis erweitern. Vielleicht fesselt einen dabei ein Werk so sehr, dass man sich für einen Kauf entscheidet – der Künstler wird danken, und das Werk kann lange nachwirken. Eine gute Gelegenheit bietet sich bei „Ateliers in Niederbayern“ am Sonntag, 14. Oktober 2018, von 13 bis 18 Uhr in 179 niederbayerischen Künstlerwerkstatten.
VK
Dem Wasser auf den Grund gehen – Bauernmalerei aus Niederbayern
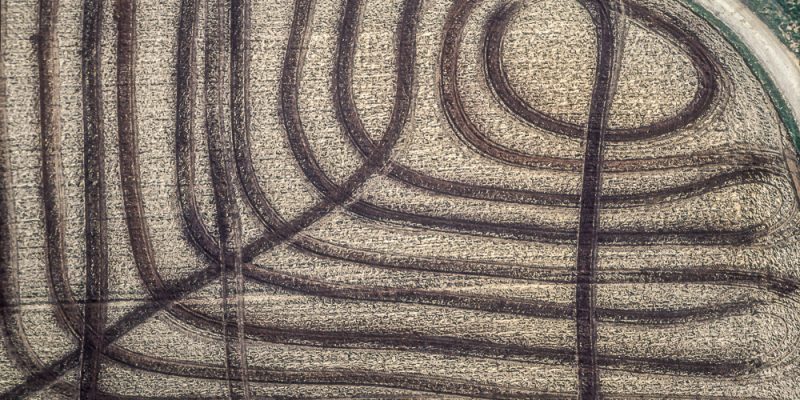
Immer mehr Biogasanlagen, immer mehr Schweineställe mit Massentierhaltung, immer größere Mengen Gülle, üppiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Kunstdünger zwingen die örtlichen Wasserversorger, Trinkwasser-Brunnen zu schließen: Sie erfüllen nicht mehr die strengen Auflagen für unser wichtigstes Lebensmittel.
Fast 40 % der deutschen und bayerischen Grundwasservorkommen sind bereits belastet. Weil höher gelegene Stockwerke bereits stark verunreinigt sind, nehmen die Bohrtiefen bedenklich zu. Sie speichern die Sünden der Vergangenheit, denn Wasser hat ein sehr langes Gedächtnis.
Gerade in Niederbayern mit dem Schweinegürtel rund um Hohenthann im Landkreis Landshut besteht höchster Handlungsbedarf. Dort scheiden Tausende von Vierbeinern mehr Gülle aus als der Boden aufnehmen kann. Die Erosion auf den Maisfutterflächen vernichtet wertvollste Böden. Ohne Agrarwende, die vor allem ohne ein Umdenken der VerbraucherInnen beim Fleischkonsum nicht erfolgreich sein kann, hinterlassen wir den nachfolgenden Generationen ein wahrlich vergiftetes Erbe.
Um die Wasser- und Bodenqualität wieder zu heben, braucht es einen langen Atem. Doch erste Erfolge zeigen, wie sich die überdüngte Kulturlandschaft sanieren lässt: durch konsequenten ökologischen Landbau, Flächenstilllegungen im Einzugsbereich der Brunnen und finanzielle Unterstützung der Landwirte, die pfleglich mit dem Rohstoff Boden umgehen. Und durch die Abkehr von der bisherigen Landwirtschaftspolitik des immer mehr, immer größer und immer billiger hin zu nachhaltiger Qualität.
Darauf weist auch ein eindrucksvoller Film des Journalisten Lorenz Knauer hin, der rund um Landshut gedreht wurde und in der Mediathek des BR- Reihe „Unter unserm Himmel“ verfügbar ist. Der Autor geht dem Thema Wasser so auf den Grund, dass wir als Zuschauer sehen und verstehen, was auf dem Spiel steht. Und die sehr eindrucksvollen Luftbilder von Klaus Leidorf zeigen, was es mit dem eigentlich so harmlos-sympathischen Wort „Bauernmalerei“ auf sich hat…
HW
Das Oktoberfest und seine regionalen Ableger

„Volksfeste freuen mich besonders. Sie sprechen den Nationalcharakter aus, der sich auf Kinder und Kindeskinder vererbt […].“ Dies ließ einst Prinz Ludwig von Bayern, der spätere König Ludwig I., verlauten. Um die Loyalität der Landeskinder zu Krone und Reich zu fördern, machten sich die Wittelsbacher und ihre Ministerialen viele Gedanken. Sie gipfelten schließlich in einem erfolgreichen Konzept, im ersten Oktoberfest, als gelungene Mischung aus gelebtem Patriotismus, vergnüglichem Volksfest und landwirtschaftlicher Leistungsschau.
Anlässlich der Vermählung des Kronprinzen Ludwig mit Therese von Sachsen-Hildburghausen am 12. Oktober 1810, dem Namenstag von Max I. Joseph, richtete die königliche Nationalgarde fünf Tage später ein Volksfest mit Pferderennen und Kinder-Trachtenpaaren aus. Letztere stammten aus den damals neun bayerischen Kreisen; sie sollten das junge zusammenwachsende Königreich mit seinen neuen Territorien repräsentieren. Dieses aus handfesten politischen wie ökonomischen Motiven geborene und zum Nationalfest hochstilisierte Oktoberfest wurde ab 1811 vom Landwirtschaftlichen Verein organisiert. Ab 1815 gab es Preise zur „Aufmunterung der Viehzucht“, „Beförderung des Anbaues“ sowie zur „Auszeichnung ländlicher Dienstboten“. Ein weiteres Jahr später kam ein landwirtschaftlicher Leistungswettbewerb mit Geräte- und Maschinenausstellung hinzu. Es ging also nicht um eine einmalige Huldigung zur Kronprinzenhochzeit. Das aufklärerische Festkonzept sollte seine regelmäßige Wiederholung und Nachahmung im gesamten Königreich finden. Deshalb wurden in den bayerischen Kreisen, den heutigen Regierungsbezirken, Volksfeste bzw. Landwirtschaftsfeste mit Viehausstellungen, Prämierungen, Pferderennen, Volksbelustigung und Festumzügen mit Trachtenpaaren aus der Taufe gehoben. Das erste Landwirtschaftsfest nach diesem Muster wurde im Unterdonaukreis, dem heutigen Regierungsbezirk Niederbayern, von König Max I. Joseph 1812 in Straubing per Dekret ins Leben gerufen. 1814 machten die Passauer ihren Anspruch geltend. Ab 1819 wechselte das Fest jährlich zwischen den beiden Städten, bis 1839 als dritte Stadt Landshut hinzukam.
Seit langem halten selbstverständlich nicht nur die niederbayerischen Städte regelmäßig ihre Volksfeste, Frühjahrs- und Herbstdulten ab. Dem Oktoberfest-Konzept am nächsten kommt hierzulande das Straubinger Gäubodenfest. Dort trifft man im Gegensatz zum international gefeierten Vorbild eher auf einheimisches Publikum. Doch die parallel stattfindende Ostbayernschau zählt mit einer halben Million Besuchern immerhin zu den erfolgreichsten Verbraucherausstellungen in Bayern.
Auf Volksfesten begegnen sich Bevölkerung, Politik und Gewerbe. Es wird gefeiert und lautstark politisiert. Bei Bier und Blasmusik vergewissert man sich seiner Identität und Wirtschaftskraft. So war es seit der Aufklärung und Industrialisierung gedacht. So ist es trotz aller Veränderungen bis heute geblieben.
MS